Ágnes Czingulszki
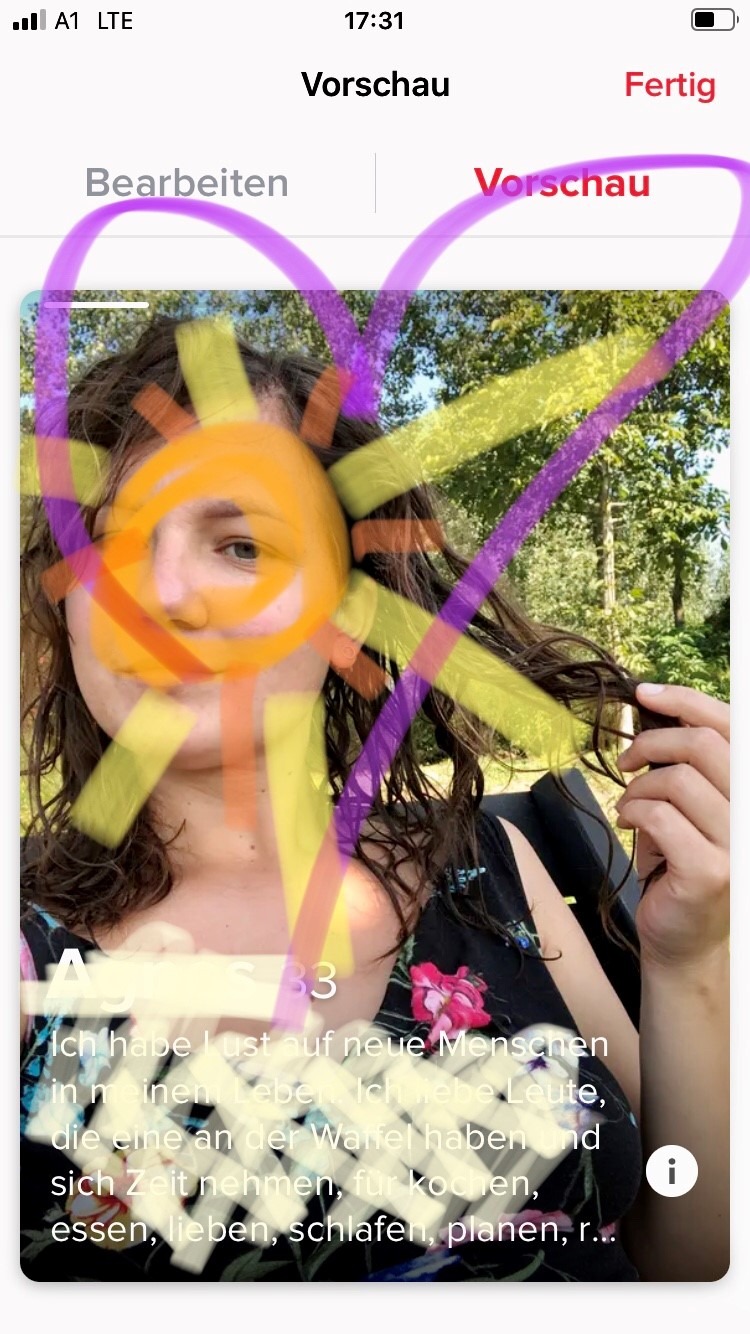
Ágnes Czingulszki
18. – 22. 01. 2021
Hören

Vor ein paar Wochen saß ich auf dem Balkon – als einem die Nasenlöcher davon noch nicht ganz zufroren – und lauschte dem Innenhof, was er heute zu sagen hatte. Die Geräusche sind in den letzten Monaten zu guten Bekannten geworden. Das Rauschen der Blätter, das Hämmern einer Schlagbohrmaschine, die Rapmusik der Nachbar-WG: unsere abendlichen Gespräche.
Ich ließ mir schon vor Tagen von meiner Mitbewohnerin eine Zigarette drehen, denn auch jetzt habe ich das Drehen nicht gelernt, und rauchte sie, zog sie tief in die Lunge bis sich dieses Gefühl einstellte, den Rauch durch die Gliedmaßen fließen zu spüren bis in die Haarspitzen und die Fingerkuppen. Wenn ich rauche, höre ich besonders gut. Ich höre die Käfer unterm Laub, wie ihre Beinchen an den vertrockneten Blättern kratzen, ich höre in einer entfernten Wohnung, wie jemand auf einer Bratsche übt, anderswo kommt aus einem Keller Bierzischen, während ein junger Mann lauthals mit seinen Freunden lacht.
Meine Konzentration gilt nur den Geräuschen, als ob mein Sehvermögen und mein Geruchssinn ihre Kräfte für mein Ohr bündeln würden und ich frage mich, ob ich auch tagsüber durch die Wände hören kann, wie jetzt, wo ein Mann und eine Frau diskutieren, eine Wange an eine Handfläche klatscht, Arme über einen Tisch fegen und Geschirr auf dem Boden zerschellt, und ob ich vielleicht Superpower besitze, nur im Alltag zu abgelenkt bin, um durch die Wände zu hören.
Seitdem der Balkon mein neues Netflix ist, um mich von der Welt abzukapseln, die mich durch Bildschirme nur mit Hoffnungslosigkeit füllt, greife ich immer öfter zu meiner Superpower. Oft funktioniert sie aber nicht. Ich ziehe den Rauch zwar ein, aber er schafft es nicht in die Haarspitzen und die Zehen, sondern bleibt ungewiss zwischen Lunge und Hals stecken. Dann wird mir übel und ich ärgere mich, dass man mich im Stich gelassen hat.
Der Himmel spaltet sich – es ist ein leises Geräusch, wie wenn man langsam einen Klebverschluss öffnet – und die Tropfen, die wie gläserne Kamikazepiloten mit hoher Geschwindigkeit gegen den Boden prasseln, greifen in die Melodie ein, es schließen sich rhythmische Knalle aus der Küche dazu und das Öffnen und Schließen von Türen. Mir wird kalt und ich gehe hinein.
Riechen

Zu pünktlich. An einem Dienstag im Mai steht der Nachbar in der Tür. Ich habe sie grad erst hinter mir zugemacht und damit gerechnet, dass ich jetzt noch mindestens zehn Minuten Zeit haben werde, weil mein Nachbar aus dem Osten kommt. Und Ost-Europäer haben ein flexibles Zeitgefühl, das sich besonders gut in die Zukunft dehnen kann. Das kann ich deswegen so sicher sagen, weil ich selbst Ungarin bin. Durch Integration und Anpassungsfähigkeit kann sich die Dehnbarkeit etwas verkürzen. Statt Stunden handelt es sich dann nur noch um Viertelstunden, bei mir sogar um ein pünktliches zu spät Kommen von zehn Minuten.
Meine Hose aufgeknöpft, die Schuhe gerade abgeworfen, öffne ich die Tür und da steht ein Typ in einem bunten Seiden-Short mit Tattoos übersät, kahlrasiert, zwischen Nase und Lippen ein bisschen Haare im Gesicht. Kurz setzt mein Herz aus und ich frage mich, auf was ich mich da eingelassen habe?… Eine SMS einfach jemand Unbekanntem schreiben, den einer meiner Freunde kennt und meinte: Der wohnt neben dir und geht auch gern joggen. Ich schlucke, ziehe mich um, während er an meiner Türstange herumturnt, und denke mir, ausprobieren kann man es ja mal.
Künftig steht er dienstags wie ein Uhrwerk vor meiner Tür, in immer neuen geschmacklosen Seiden-Shorts, die ich unmöglich finde. So lächerlich ich sie am Anfang empfunden habe, so schön finde ich sie an seinen langen Beinen von Mal zu Mal. Ich habe es nicht geplant, aber plötzlich rast mein Herz schon ab dem Zeitpunkt, da ich die Laufschuhe anziehe und mir die Klingel, die er viel zu lange drückt, durch Bein und Mark geht.
Eines Tages mache ich die Tür auf und wir haben keine Shorts und Laufschuhe an, wir laufen nicht auf Asphalt und Waldboden nebeneinander, wir erzählen uns nicht von Cousins und Vätern und ein Leben, das vor den Laufdienstagen passiert ist, sondern wir sitzen an einem Tisch, es steht eine Weinflasche zwischen uns und mir fallen Fischstückchen von der Gabel. Das macht nichts, wir küssen uns trotzdem, nachdem die Flasche leer ist und endlich erobere ich diese Zähne, die ich seit Wochen beim Dehnen ansehe und die ich seit Wochen gerne anfassen würde. Ich bin ihm so nah, dass ich die weißen Körnchen um seine Augen herum sehe. Diese kleinen, die man von hohem Cholesterin bekommt und sein Geruch ist anders als beim Laufen. Beim Laufen riecht er nach Metall, Salz und frischgebackenen Brötchen. Er riecht nach Warm. Jetzt riecht er nach gewaschener Haut und Zahnpaste. Nach Zivilisation, nicht nach Stärke. Ihm wachsen Haare auf der Glatze und ein Glanz in den Augen und ich vergrabe mich in seinem Körper Ich weiß noch nicht, dass es kein Daunenbett mit fluffigen Federn ist, sondern ein Schützengraben, in dem unvorhergesehen die Bomben fallen und Löcher in mich hineinfetzen. Immer, wenn wir wieder tot füreinander sind, alle Chatverläufe gelöscht, die Klingel stumm, gibt es nur einen Weg, uns wieder zu versöhnen. Wir müssen uns zufällig auf einem Zebrastreifen begegnen, ich muss den Schritt auf ihn zugehen, ich muss zuerst die Arme um ihn schlingen. Dann reden wir einige Sekunden gar nicht, ich atme die fluffige Daunendecke wieder in mich hinein und vergesse, dass ich mitten im Krieg bin, dass das, was wir haben, nie Liebe sein kann, dass das, was wir haben, eigentlich ständige Furcht vor der nächsten Bombe ist. Wenn ich ihn umarmt habe, kann er trotzdem nicht mehr Nein zu mir sagen, ich fange ihn mit dem Geruch, der mich umgibt.
Es ist November und die Bomben kommen häufiger. Um die Wunden zu versorgen, gibt es kaum mehr Zeit, schon kommt der nächste Angriff. Egal. Ich stürze mich trotzdem in diesen Körper und halte ihn erneut am Zebrastreifen an, danach sagt er, auf einem Sofa sitzend: „90 Prozent“ und dass ich gehen soll, denn er kann mich nicht mehr riechen, mit seiner Nase, einfach wortwörtlich und, dass mein Geruch neunzig Prozent davon ausmacht, was er gut an mir findet. Ich lache und verhandle, bis wir auf vierzig Prozent kommen. Dreißig Prozent bekomme ich noch für meine Klugheit und dreißig Prozent für meine Schönheit. Und dreißig Prozent, weil ich manchmal lustig bin. Aber das sind die Bonus-Prozente, die nicht immer zutreffen. Zu welchen Prozenten er was an mir hasst, besprechen wir diesmal nicht.
Obwohl ich nachts neben ihm kaum schlafen kann, weil das Blut in meinem Körper ständig rast, liege ich gern bei ihm. Sein Zimmer riecht staubig, seine Fenster klappern, seine Wände werfen das flatternde Licht seines Bildschirms aufs Bett. Ich versuche mich an seinen Körper zu schmiegen, die Körperstellen, die nicht zugedeckt sind, mit meinen Beinen und Armen zu ummanteln, meinen Kopf lege ich unter seine Achsel. Daraus kommt am meisten er, aus dieser Kurve seines Körpers, und ich liege dort und fühle mich wie in einem Drogenrausch, weil ich weiß, dass das nicht gut ist, dieses Liebe Spielen, aber nicht Liebe Können.
Ein paar Tage später schreibt er mir eine SMS. „Geh nicht außer Haus. Ich habe Corona“ – und ich bleibe in meinem Zimmer allein, zehn Tage lang. Unsere Versöhnung hat damals nicht funktioniert und jetzt bin ich auf Entzug. Ich muss allein aufräumen, in diesem Kriegsgebiet Ordnung schaffen, die Bombenkrater zudecken, Bäume Pflanzen, Blumenbeete anlegen und zusehen, dass ich mich endgültig abgewöhne. Auch die Klingel drückt niemand mehr zu lange.
Sehen

Manchmal sitze ich einfach auf meinem Heizkörper und schaue auf die Straße. Wer groß genug ist und in diesem Moment zurückschaut, sieht mir dann direkt ins Gesicht. Im Sommer sitze ich bei offenem Fenster und esse in der Sonne mein Mittagessen, dann wünschen mir meine Fußgänger-Freunde Mahlzeit und ich nicke zurück. Von meinem Fenster aus ist die Welt sehr klein. Einige Meter weiter gibt es schon die nächste Mauer, Fensterausschnitte mit einem Treppenhaus und schiefen Ordnern unter Neonlicht. Ich warte auf den Moment, in dem die vielen Ordner in einem Dominoeffekt umkippen, aber seit zwei Jahren passiert nichts. In den Räumen sehe ich selten jemanden. Als ob es in diesem großen Haus außer den Ordnern, den Treppen und dem Neonlicht nichts geben würde.
Einige Menschen kenne ich aber von der Straße. Sie suchen mit ihren alten Volvos ständig Parkplätze oder überqueren die Kreuzung mit einer Kiste Bier. Es gibt auch diesen alten Mann, er kommt aus einem Hauseingang von schräg gegenüber und hält seinen Enkelsohn an der Hand. Manchmal schubst der Enkelsohn seinen Großvater, der einen Schritt zurücktreten muss, dann nimmt der Großvater ihn wieder an der Hand und sie gehen zusammen weiter, als ob nichts geschehen wäre.
Mit den Jahren wird aber der Großvater kleiner und der Enkelsohn größer. Die Schritte, die er machen muss, wenn sein Enkel ihn schubst, werden mehr, er kommt öfters ins Wanken. Wenn ich sie von meinem Fenster aus sehe, möchte ich gerne dazugehören. Nicht wegen der Schubserei, sondern wegen den zwei Händen, die sich immer wieder finden.
Dieser Großvater kommt aus einer anderen Welt. Ein Lächeln unter der dunklen Schildkappe, ein geordnetes Gesicht, wie jemand, der nur körperlich ins Wanken kommt. Ich stelle mir vor, wie gut es mir tun würde, einfach neben ihnen herzugehen. Der Enkelsohn würde seine komische Sprache sprechen, würde seine schweren Schritte tun und ich würde auf der anderen Seite des Großvaters wie ein Schatten mitgehen, ihn von den Augenwinkeln betrachten und kurz Teil der Ruhe sein.
Ich habe den Enkelsohn auch einige Male mit einer kleinen Frau gesehen. Vielleicht ist es die Schwester oder die Mutter, ich könnte es nicht sagen. Sie ist schmal und zierlich und sieht wie ein Mädchen aus. Über ihrer Schulter eine elegante Tasche, auf ihren Füßen Schuhe mit dünnem Absatz. Der Enkelsohn ist schon längst stärker als sie, im Gesicht der Frau Falten der Wut, Anstrengung und Erschöpfung, wenn sie mit ihm geht. Sie hat keine Zeit für das Schubsen und Wiederfinden. Es ist ein „Amarmweiterzerren“, wenn sie mit ihm unterwegs ist.
Ich habe die Frau, den Enkelsohn und den Großvater von meiner Fensterbank aus so oft beobachtet, mir so oft über sie Gedanken gemacht – woher sie kommen, was sie in Innsbruck tun, was der Enkelsohn für eine Krankheit hat, wann der Großvater umfällt und nicht mehr aufsteht –, dass es mir eines Tages wie selbstverständlich vorkommt, den Großvater und den Enkelsohn auf dem Gehsteig zu grüßen. Und der Großvater zeigt auf unsere Tür, an der ein Zettel hängt: Was steht dort, fragt er mich, wie ein tibetischer Mönch, der mir ein Rätsel stellt und ich lese es ihm vor. „Bitte, den Schlüssel ganz umdrehen. Das Schloss wurde repariert“ und erkläre, es sei für den Postmann, der seit einigen Tagen immer klingelt, weil er glaubt, sein Schlüssel funktioniere nicht mehr. Der Großvater nickt mit diesem unbeirrbaren Lächeln – eine Bestätigung, das Rätsel richtig gelöst zu haben – und geht weiter auf die Kreuzung zu, mit dem Enkelsohn an der Hand, der nach einer kleinen Pause seine unverständliche Sprache fortsetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade den Star meiner Lieblingsserie getroffen.
Tasten (für J.)

Niemals, niemals werde ich das machen. Es ist das Pilze Essen meines Erwachsenenlebens und doch habe ich es gemacht. Jetzt habe ich es doch noch gemacht. Dieses Hin- und Herwischen von Männern und Frauen. Es war einfach plötzlich da. Dieses Gefühl: Es ist egal, niemandem muss ich beweisen, wie ursprünglich und echt und natürlich ich bin. Ich gewinne Einblicke in eine neue Welt, in die ich nie Einblicke gewinnen wollte. Wenn sowieso unser aller Leben in der gewohnten Art zerbröselt, kann ich auch ein wenig zerbröseln. Und Spaß macht es auch, die Brösel wieder zu was Neuem zusammenzuschieben.
Allabendlich sitze ich vor diesem kleinen Bildschirm und habe mittlerweile so viel Erfahrung, dass ich mit erschreckender Geschwindigkeit tippe, wische, tippe, wische, tippe, wische und in wenigen Sekunden Menschen in Schubladen stecke. Aha. Nur zwei Bilder. Der will nichts von sich preisgeben. Aha. Mit anderen Mädels und einem Motorrad. Das ist ein Gigolo. Aha. Skifahren, Skaten, Klettern. 0815-Innsbruck-Style. Die Menschen fließen zu einer Masse zusammen und, wenn mich aus dieser Masse jemand auch mag, erscheint er plötzlich in einer Leiste, gemeinsam mit anderen kleinen Bildern am oberen Rand meines Handys. Manchmal wundere ich mich: Habe ich wirklich diese Menschen nach rechts gewischt?
Ein digitaler Harem, der nicht besonders nützlich ist. Die Begegnungen: Das moderne Zwinkern eines fremden Menschen über einen digitalen Bartisch hinaus. Ein Punktesammeln im Liebessystem. Es sind kleine Bewegungen, man muss sich keinen Moment lang körperlich, seelisch oder psychisch anstrengen, um irgendwo anzukommen. Eigentlich sollte das schon alarmierend sein. Der Daumen und der Zeigefinger springen in Millimeterabständen links und rechts, wischen nach unten oder nach oben. Fehler passieren mir kaum mehr. Ich vergebe keine Extrapunkte mehr aus Versehen.
Während ich mich in dieser Punktewelt aufhalte, denke ich nicht daran, dass ich mit meinen Fingern eigentlich lieber Buchstaben auf Haut schreiben würde und dass unter meinen Fingern diese Haut zur Gänsehaut werden sollte. Danach könnte ich die Gänsehaut küssen. Nein. Ich beobachte mich einfach. Ein anthropologischer Feldzug, in dem ich mitten drin bin.
Beim Schreiben mit den Männern habe ich keine Masken auf. Ich bin, wie ich bin. Ein bisschen durchgeknallt und ein bisschen kompliziert. Es ist schon vorgekommen, dass mich Männer aus ihrem digitalen Harem-Leisten rausgeworfen haben. Das musste ich erst mal googeln, weil ich das nicht verstanden habe, dass sie einfach so verschwunden sind. Ich wusste nicht, dass so etwas geht. Auf Deutsch gesagt, man wird ohne Erklärung abserviert.
Es tut mir kein bisschen weh. Ich finde es eher unterhaltsam. Treffen will ich die Männer und Frauen eigentlich nicht. Dafür ist mir der Aufwand zu groß und meine Zeit zu schade. Im wahren Leben wäre das anders. Wie dieser eine Mann, den ich vor ein paar Jahren in den Bögen angesprochen habe. Wir haben uns prächtig miteinander unterhalten, aber meine Freunde warteten auf mich, deshalb habe ich vorgeschlagen, das Gespräch bei einem Kaffee weiter zu führen. Er sah mich an – sogar durch den dicken, romantischen Rauch hindurch war sein Blick vernichtend – und meinte: „Wie alt bist du denn?“ Und meinte dabei nicht, dass ich zu jung für ihn wäre. Das Gefühl, das ich sofort bekam: Jemand zieht mir den Magen mit einem Ruck durch den Rachen. In der digitalen Welt passiert dir das nicht. Es passiert nicht dir, sondern nur deinem Abdruck. Einer Essenz, die nur einen kleinen Teil – nicht besonders echt oder ehrlich – von dir ausmacht und somit zählt es auch nicht, wenn dir jemand mit einem digitalen Ruck deinen digitalen Magen durch deinen digitalen Rachen zieht.
Ich habe mir auch schon überlegt, die Match-Methode umzusetzen. Im wahren Leben. Wenn ich einen Menschen sehe, der mir gefällt. Ich wische mit der Handfläche einfach nach rechts – es könnte sogar als Begrüßung durchgehen – und fange mit ihm zu reden an. Vielleicht begegnet man neuen Menschen so einfacher. Aber Begegnungen sind rar geworden. Auch wenn sich Leute zwischen Topfenaufstrich und Tomatensauce länger in die Augen schauen. Die Form ihrer Nasen, die Krümmung ihres Lächelns, die Straffheit ihrer Backen, wo sich die Muttermale befinden, wie dick die Lippen sind und ob sie ein Kinn mit Loch haben – alles formt man weiter, wie man will. So vielen schönen Personen bin ich noch nie begegnet.
Die Sehnsucht spüre ich erst dann, wenn ich den Bildschirm ausmache, wenn mein Harem sich in nichts auflöst und ich im Dunklen unter der Decke liege. Ein kaltes Bein wärmt das andere kalte Bein und ich stelle mir vor, wie das doch war, als man sich umgedreht hat und einem anderen Menschen über den nackten Rücken wischte. Haut an Haut. Handfläche an Wirbelsäule. Dafür würde ich dieses andere Wischen sofort in den Eimer werfen. Ah ja. Mist. Wie konnte ich es nur vergessen? Analog nennt man das Wischen eigentlich Streicheln.
Schmecken

Wir saßen in unserer Küche und lachten. An den Wänden Kacheln, wie aus Lissabon, weiß und blau, und obwohl wir genug Stühle hatten, stand M. zwischen uns. Als Schiedsrichterin, als Verteidigerin, als verbindendes Element von zwei Unbekannten. Sie händigte uns Teller aus und wir begannen zu essen, hörten aber nicht auf zu lachen. O. lud uns ein, er werde in ein paar Wochen wegziehen, wir müssten zusammen seinen Wein trinken, weil er die Flaschen nicht mitnehmen könne.
Ich ging alle paar Tage in seine Wohnung, die durch den sukzessiven Umzug von Tag zu Tag weniger wurde und wir tranken die Flaschen der Reihe nach, von links nach rechts. Flaschen aus Österreich, aus Italien, aus Frankreich und sogar aus Georgien. M. hatte keine Zeit und war nie dabei. Die Flaschen leerten sich auch ohne sie. Und so wie sich die Flaschen mit dem Wein leerten, so öffneten sich unsere Augen. O. und ich erkannten Gemeinsamkeiten und nach einigen Tagen klopfte ich nicht mehr als eine Bekannte einer Bekannten an seiner Tür, die nichts Besseres zu tun hatte, sondern als Freundin, die sich nichts Besseres vorstellen konnte, als an diese Tür zu klopfen. Ich fotografierte die Schatten seiner Wohnung, die Gläser in den Vitrinen, das Licht im Flur und ich war der festen Überzeugung, dass diese Wohnung ein Ort des Glücks ist, in dem es wachsen kann, während draußen die Welt anhielt und der Stillstand aus jeder Straßenritze triefte. Hier wuchs ein Dschungel voller Lebensfreude.
Eines Tages öffnete O. wieder eine Weinflasche während wir kochten. Es gab Fisch mit Salz, Pfeffer und Zitrone, dazu ein schöner Salat. Während der Wein von der Flasche in die Gläser floss, sah ich schon, dass das ein Guter war. Er rann das Glas sofort nach unten und zog an der Wand diese hübschen Linien hinter sich. Ein Wein mit Charakter, der sich seine Bahnen selbst aussucht.
Ich war nie eine Weinkennerin. Nie verstand ich die Erklärungen, die Menschen zur Beschreibung von Weinen gaben. Nussig, beerig, rauchig. Wahrscheinlich ist es einfach eine profunde Art der Lyrik, eine Dichtung der Erinnerungen, Emotionen und Erlebnisse, die man im Leben gesammelt hat und nun in einer Weinflasche – die Essenz hunderter Trauben, die bei Wind, Sonne, Regen und Kälte heranwachsen – wiederentdeckt.
Wir stießen mit dem bernsteinfarbenen Wein an und ich nahm einen Schluck. Um mich herum verschwanden die Küche, der Herd und O. und ich hatte das Gefühl, ich bin in diesem Wein drinnen und nicht umgekehrt. Dass ich über dreißig so etwas spüren würde, konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. So etwas ist nur heranwachsenden Kindern vorenthalten, die zum ersten Mal im Leben einen neuen Geschmack entdecken. Der Wein war nicht nussig, beerig oder rauchig, ich hätte nicht wirklich beschreiben können, wie er schmeckte, nur, was ich spürte. Zuhause und gleichzeitig weit weg sein. O. machte sich Sorgen, als er mein versteinertes Gesicht sah, und fragte mich, ob alles in Ordnung sei, mir der Wein nicht schmecke. “Der Wein, der ist so gut.“ Ich konnte es nur so plump in Worte fassen, wie verzaubert ich von diesem absonderlichen Geschmack war, der mich gleichzeitig an weite Reisen in die Wüste und an mein sonniges Zimmer in einem kleinen ungarischen Dorf erinnerte. Das nennt man Liebe auf den ersten Schluck. Ich schwenkte das Glas hin und her, ließ den Wein für mich schaukeln und trank ihn, so langsam ich nur konnte. Aber, wenn man verliebt ist, trinkt man auch dann zu schnell, wenn man glaubt, langsam zu sein. Die Flasche war leer und ich versuchte nicht an den Wein zu denken, sondern mit O. Schalplatten zu hören, zu tanzen und den Dschungel unserer Lebensfreude Weiterwachsen zu lassen.
Er wurde ein kleiner Dschungel, dafür umso dichter. Manchmal auch im wortwörtlichen Sinn, denn ich kam noch einige Male, um Wein zu trinken, Essen zu kochen und zu Schallplatten zu tanzen. Anfangs waren Bilder an den Wänden und Bücher in den Regalen und zum Schluss war nichts mehr da. Außer ein paar Gläser, ein Tisch und zwei Stühle. Ich kenne niemanden, der so langsam ausgezogen wäre, ein umgekehrtes Einziehen war das, was ich bei O. miterlebt habe. Dann war O. tatsächlich weg, zuletzt brachten wir noch die Weinflaschen zum Müll. Das Klirren der zerschellenden Flaschen der Abschiedsklang unserer kurzen Freundschaft. Wir hielten uns nochmal an der Hand und schauten uns nochmal in die Augen und ich trank sehr lange keinen Wein mehr und kochte auch nicht so gutes Essen. Wieder triefte aus jeder Straßenritze der Stillstand und jeden Tag fühlte ich ein neues Nichts.
Ich wollte wissen, welchen Wein wir getrunken haben, ich hatte vor lauter Erregung nicht auf das Etikett geschaut, aber als ich O. nach seiner Abreise per Chat fragte, wusste er es selbst nicht. Er schickte mir Bilder von Weinflaschen, die mir alle bekannt vorkamen, aber ich hätte nicht sagen können, welche es war. Vielleicht war es gar nicht der Wein. Vielleicht war es dieses gehobene Gefühl mit O. in dieser schönen Küche, mit dem schönen Essen und dem schönen Salat, in mir die Offenheit für all die Schönheit, ein Stargate-Moment, der nie wieder zurückzuholen ist. Diesen Moment in irgendeiner Form nachzuahmen, mit Wein, mit O., mit Fisch, mit Salz – das wäre sicheres Scheitern. Die Lehre aus dem Dschungel: Manchmal muss man loslassen können, um es weiter zu genießen.








